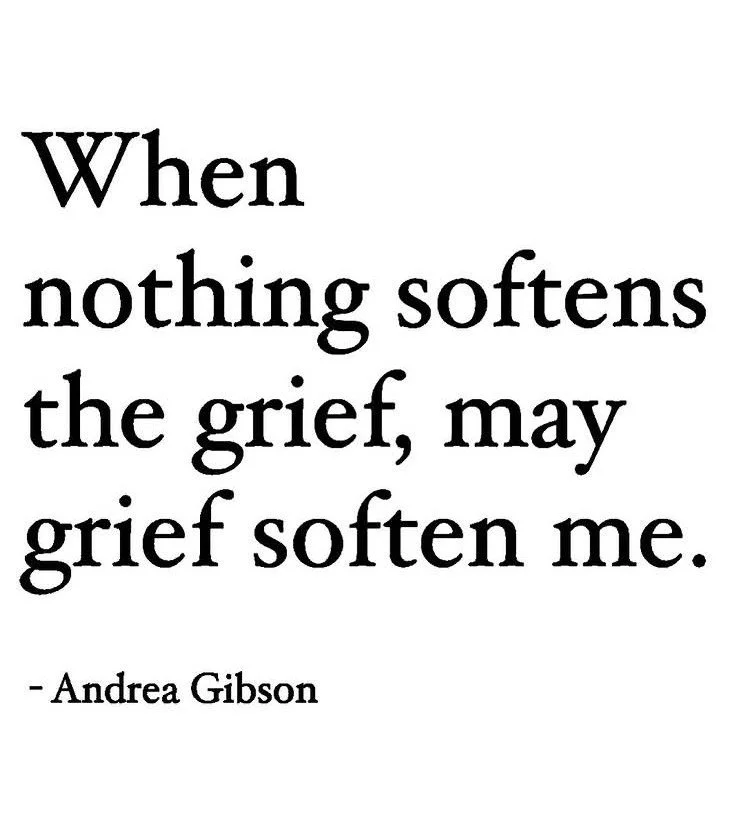DER POLIZIST IN MEINEM KOPF
“DIE EMPÖRUNG SCHIMPFT SICH AUS, DIE WUT LÄSST SICH ABLASSEN. DER HASS BLEIBT.”
Şeyda KURT
“Sag mal, hast du sie noch alle? Das ziehst du nicht an!”
Meine Mutter war sonst eher die ausgleichende Kraft in unserem Haushalt, sie war dafür da, um die Tyrannei meines Vaters im Schach zu halten. Aber heute nicht. Heute schrie sie mich an und riss übergriffig an meinem Outfit herum.
Ich war zwölf, hatte schon zwei mal Goethes Faust gelesen und schrieb Gedichte in kleine Notizbücher, aber in letzter Zeit hatte ich Brüste bekommen und ich musste viel über den gemeinen Jungen in meiner Klasse nachdenken, der alle mobbte. Auch wenn ich wusste, dass ich keine Chance bei ihm hatte, beschloss ich, dass es Zeit war, männliche Aufmerksamkeit zu bekommen.
Es waren die 2000er und nichts war mehr y2k als sich komplett über männliche Aufmerksamkeit zu definieren. Also hatte ich aus den alten Klamotten meiner großen Schwester einen pinken Minirock und ein enges weißes Shirt mit einem großen runden Ausschnitt herausgewühlt und stand jetzt bereit für den Schulbesuch an der Tür.
Meine Mutter fand das gar nicht witzig. Aller Widerstand half nicht, mit eiserner Mine befahl sie mir, mich umzuziehen, bis ich in Jeans und ein weites grünes T-Shirt schlüpfte und wieder intelligent aussah.
Klar musste ich mehr machen als andere. Das war quasi qua meiner Geburt festgeschrieben.
Wenn es an der Uni um Foucault ging, dann war ich diejenige, die es gelesen hatte. Die meisten anderen wussten, dass man Texte nur strategisch liest und laberten ansonsten irgendwas, was aus ihrer langen Kindheit voller Zeitung lesen am Küchentisch.
Meine Eltern sind ostdeutsch und lebten eine großen Teil meiner Kindheit von Hartz IV. Mein Vater war ein Narzisst und gescheiterter Künstler, der sich Marxist nannte und jede Theorie las, aber eigentlich keine armen Menschen mochte. Außer Fotos, Büchern und Trauma hat er uns nicht viel hinterlassen. In den letzten Jahren hatte ich fast keinen Kontakt mehr zu ihm. Meine Mutter dagegen, - immer zwischen prekären Jobs, Aufstocken beim Jobcenter, die Queen der Care-Arbeit, vier Kinder und ein riesengroßes Manchild, um das sie sich ihr Leben lang kümmern musste, - hat zum Schluss noch seine Pflege übernommen.
Die Beantragung einer Pflegestufe, um Pflegegeld zu bekommen, hat letztendlich einfach zu lange gedauert, immer wieder fehlten Unterlagen oder mein Vater sperrte sich aus Scham. Je weniger er selbst machen konnte, desto mehr wuchs meine Mutter über sich hinaus, das war schon mein ganzes Leben lang so, aber desto erschöpfter wurde sie auch und desto schlechter fühlten wir Kinder uns.
Trauern ist Arbeit, so wie alle Formen der Liebe, und die Care-Arbeit landet dann natürlich schnell bei den weiblich sozialisierten Personen in der Familie. Meine Schwester, meine Mutter und ich beklebten in liebevoller Feinarbeit die Urne, jetzt liegt sie irgendwo unter der Erde und wir haben nicht mal eine Insta-Story draus gemacht. Wie erbärmlich unproduktiv. In dieser ganzen Zeit hat irgendwer drei Businesses auf Bali aufgebaut und ich war nicht mal im Fitti. So bellt der neoliberale Polizist in meinem Kopf.
Vor allem geht es beim Sterben natürlich um Geld. Es ist teuer, lasst es lieber, irgendwer muss den Shit dann bezahlen. Bestattungsinstitut, Sterbeurkunde, Friedhofsgebühren, Versicherungen. Keine Ahnung, was teurer ist, sterben oder leben, aber prekär war es bei uns immer. Krank war mein Vater schon lange, aber als er stirbt, geht alles sehr schnell und ich kämpfe mich gerade selbst durch eine Brustkrebstherapie. Zu dieser Zeit habe ich keinen Kontakt mehr zu ihm, eigentlich nur über meine Mutter. Ich sitze trotzdem an seinem Sterbebett. Ich wünsche ihm Frieden at last und halte seine Hand. Wie immer schlimm es auch war, jeder hat einen würdigen Tod verdient, daran glaube ich und erst mal heißt es jetzt natürlich organisieren, kümmern, durchziehen. Erst Monate später, als ich die Krebstherapie überstanden habe und mein personal life im Chaos versinkt, bricht es plötzlich über mir zusammen. Ich kann nicht mehr arbeiten, kann nicht mehr denken, honestly, ich fühle den Schmerz den ganzen Tag.
Erinnerungen holen mich ein, die guten, die schlechten, die wirklich schlechten. Irgendwer sagt mir immer wieder, Girl, du musst trauern, das ist ganz normal. Ich höre das wie ein Mantra in meinem Kopf. Du musst trauern, du musst trauern. Aber wie geht trauern? Ich mache, was ich immer mache, wenn ich den Schmerz nicht ertrage, ich kümmere mich um irgendwen anders, ich haue ab auf Demos und in Bars mit Menschen, die ich nicht zu gut kenne, ich ghoste meine Freunde, bloß nicht drüber reden, ich fahre weg ans Meer. Ich lande in Istanbul. Einige Tage kann ich kaum aufstehen, die nächsten Tage laufe ich durch die Stadt und trinke zehn Kaffee, aber esse nicht. Hauptsache kein Heroin. Girl, du musst trauern. Gleichzeitig läuft das Leben weiter. Instagram läuft weiter, der Leistungsdruck läuft weiter. Nie genug sein läuft weiter. Schönheitsideale laufen weiter. Zumindest bin ich jetzt dünn, weil ich nichts mehr esse.
reiß dich zusammen, denke ich, wieviele Väter sterben jeden Tag in Gaza, Kongo und Sudan und wieviel schlimmer ist es, wenn dein Kind vom IDF niedergemetzelt wird, als wenn dein Vater mit Ende 60 und nach langer Krankheit stirbt. Ich öffne Social Media, Genozid in Gaza im Live Stream seit zwei Jahren. Jeden Tag schaue ich mir die Videos an. Ich habe eine Bildschirmzeit von sechs, sieben Stunden am Tag, als wäre ich eine gottverdammte Influencerin, dabei habe ich nebenbei eine 30 Stunden-Stelle in der Geflüchtetenhilfe. Ich weiß ganz genau, wessen Leben etwas wert ist und wessen Leben nicht in unserer Gesellschaft. Das wissen wir alle. Wo siist die kollektive trauer für all die Menschen, die in Gaza gestorben sind? Kinder, Väter, Gefangene, es ist mir egal. Gebt ihnen eine verdammte Beerdigung und liefert keine Waffen mehr für einen Genozid.
Und dann überfällt mich die Scham - was soll die white guilt, was hat jetzt wieder das eine mit dem anderen zu tun? Wem will ich beweisen, was für ein guter Mensch ich bin? Warum soll ich mir nicht die Zeit nehmen, um meinen Vater zu trauern? Ich habe doch gerade gesagt, jeder verdient einen würdigen Abschied. Girl, du musst trauern. Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung wie man trauert. Ich frage Chat GPT- wie machen die das mit dem Trauern in anderen Kulturen? Es kommen dann Beispiele wie der Día de los Muertos in Mexiko, da tanzen sie und feiern und essen und laufen verkleidet durch die Stadt. Ob das hilft? Zumindest sind sie in Gemeinschaft. Auf Sulawesi in Indonesien gibt es das Ritual Ma’Nene, bei dem die Toten exhumiert, neu eingekleidet und durchs Dorf geführt werden. Ob das hilft? Ich glaube, mir würde es nicht helfen, mit meinem toten Vater herumzulaufen, aber zumindest tun sie es in Gemeinschaft.
Ich weiß, es war eine schlechte Idee, allein wegzufahren. Aber ich will mit den Gefühlen sitzen, ich will alles fühlen, die Heftigkeit, die Leere, die Trauer, um sie loszulassen. Sich diese Zeit zu nehmen in einer neoliberalen Welt ist absurd. Was soll ich für Selfies auf Instagram posten, während ich heulend am Strand sitze. Ich sitze dort und ich schäme mich, dass ich nicht funktioniere. Wenn ich Instagram öffne, sehe ich Memes über Mental Health und schäme mich, dass ich mich schäme. Und ich schäme mich, weil ich weiß, dass eigentlich sonst auch niemand in meinem Umfeld diese Zeit hat. Wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist und ein naher Angehöriger stirbt, kann man sich im Durchschnitt 2-3 Arbeitstage frei nehmen. Je prekärer der Job ist, desto schwieriger wird das. Wenn du selbstständig bist, musst du eh funktionieren. Der Tod meines Vaters wird mich noch lange begleiten. Ich trauere nicht nur um ihn, sondern auch um die verlorenen Versionen meiner Selbst, die ich durch seinen emotionalen Missbrauch verloren habe . Ich trauere um die verlorenen Jahre meiner Kindheit und um Freundschaften und Beziehungen, die daran zerbrochen sind.
Womit wir wieder bei der Gemeinschaft sind. Es wurden schon viele schlaue Artikel geschrieben darüber, dass wir den Tod in westlichen Gesellschaften verdrängen, dass wir nicht an unsere eigene Sterblichkeit erinnert werden wollen und so weiter. Kollektives Trauern – das kenne ich nur aus politischen Kontexten: Hanau, Polizeimorde wie George Floyd, zuletzt Lorenz, Kundgebungen zu Opfern von Femiziden - da habe ich erlebt, wie stark kollektives Trauern sich anfühlen kann. Da habe ich auch gelernt, dass Trauern Kämpfen bedeutet, Kämpfen für das gute Leben für alle, für eine würdigere Gesundheitsversorgung, sodass mein Vater die letzten Jahre nicht so gelitten hätte und meine Mutter entlastet worden wäre, kämpfen für antikapitalistische Strukturen, in denen er sich besser hätte entfalten und glücklicher hätte sein können und seine patriarchalen Denkmuster hinter sich lassen.
Kämpfen auch für eine Gesellschaft, in der niemand in seiner Trauer allein gelassen wird. Für ein kollektives Bewusstsein, das sich nicht vom Tod bedroht fühlt, sondern ihn ins Leben integriert. Ob wir nun als Skelette verkleidet durch die Gegend laufen oder was auch immer eben hilft. Für eine Gemeinschaft, in der es für jeden Femizid einen Trauermarsch gibt, für jeden erfrorenen Obdachlosen, für jeden Toten - ob an den europäischen Außengrenzen, in Gaza, in Kongo, Sudan oder sonst wo. Ich wünsche mir, dass ich auf offener Straße frei über meine Trauer sprechen kann, so wie ich sie fühle und ohne sie zu romantisieren oder fein säuberlich zuhause zu verstecken. Trauer ist Liebe ohne Ziel oder so heißt es doch in den Spruchkalendern. Ich wünsche mir, meine Liebe in die Welt hinauszuschreien.
Ich schreie natürlich nicht. Stattdessen laufe ich hochkoffeiniert durch Istanbul, in meiner Tasche die alte Polaroid-Kamera meines Vaters. Sie ist wirklich alt, so alt, dass sie diese alten Color Spectra Polaroid Filme braucht, die nicht mehr produziert werden. Ich habe drei gebrauchte Filme auf Ebay-Kleinanzeigen gefunden, von denen einer komplett beschädigt ist und die anderen beiden nur halb. Ich laufe durch die Stadt und mache Fotos von Szenen, die mein Vater geliebt hätte – ein Antiquariat, ein alter Schachtisch, Aufnahmen von Meer und Natur - und von Dingen, die er gehasst hätte – ein trashiges Labubu, Menschenmengen auf dem Großen Bazar, eine Truppe mackeriger Dudes in einer Shisha Bar. Szenen, über die er sich aufgeregt hätte, über den Kulturverfall, den Kapitalismus, Social Media, der Trash und die Armut, von denen er sich so sehr abgrenzen wollte. Es ist mein eigenes kleines Trauerritual, ein letztes Streitgespräch mit ihm, von denen wir so viele hatten, ein letztes Aufbegehren gegen seine Kontrolle, ein liebevolles „In your face“ mit all den profanen Dingen, die halt existieren, ob er wollte oder nicht. Irgendwann muss ich dann zurück, meine Liebesbeziehungen habe ich ins Chaos gestürzt, meine Freunde sind sauer, weil ich sie geghostet habe. Ich wünschte, ich hätte mich besser öffnen können, hätte sie mitnehmen können, hätte all die Instagram Posts über Mental Health befolgt, die ich den ganzen Tag like. Ich wünschte, ich würde selbst die Gemeinschaft mehr leben, die ich mir so wünsche und nicht jeden Tag an den kapitalistischen Strukturen und meinem eigenen Performance- und Leistungsdruck scheitern. Ab jetzt, nehme ich mir vor. Ab jetzt.